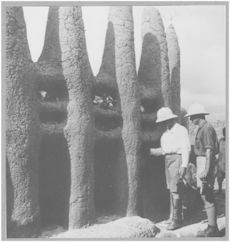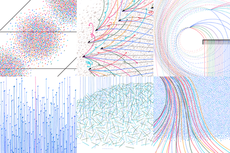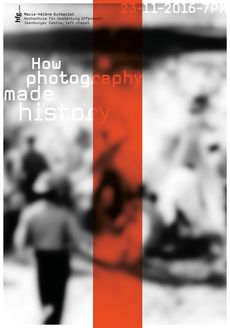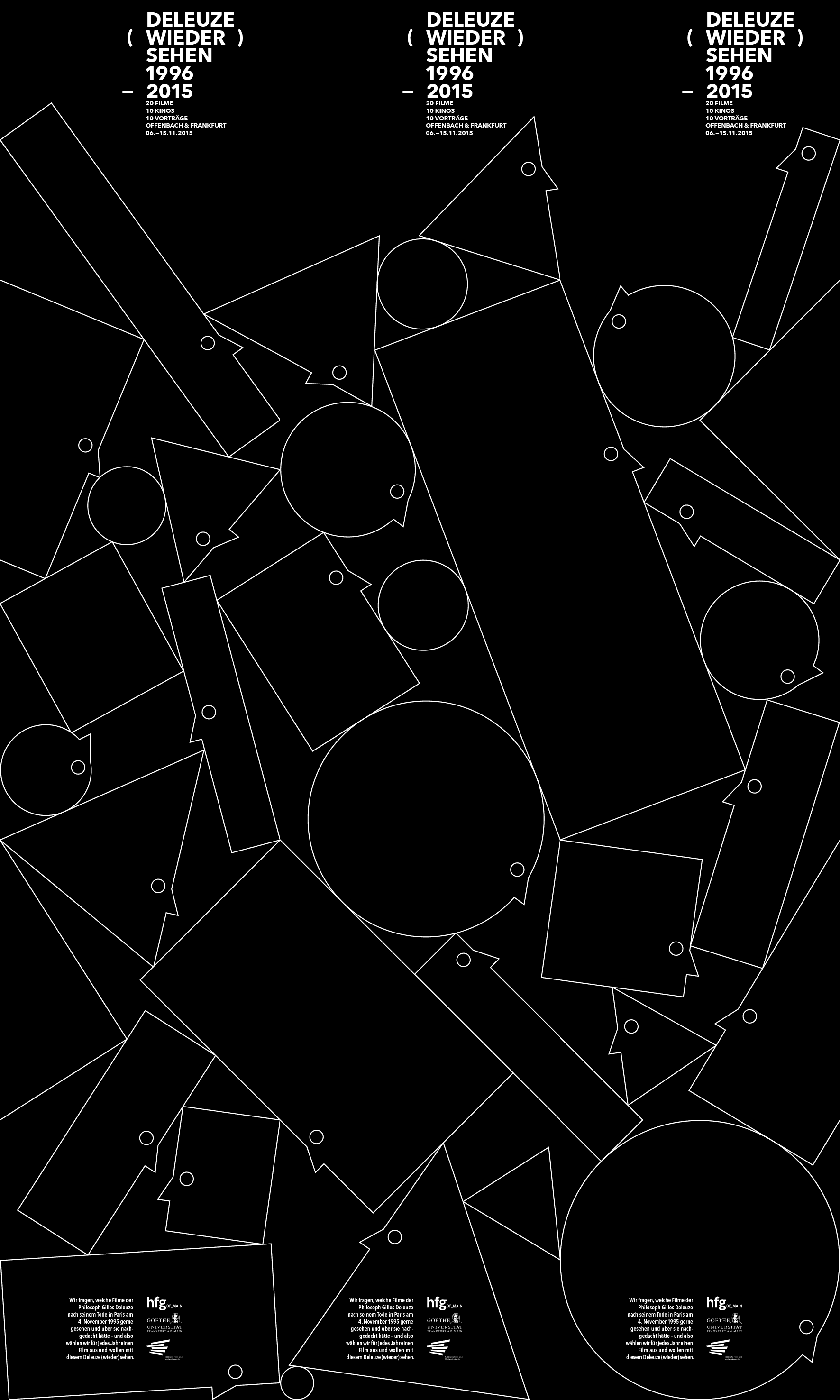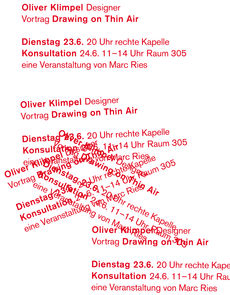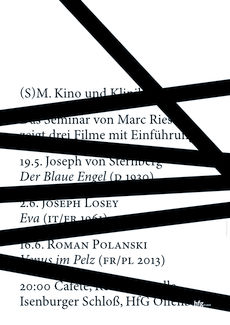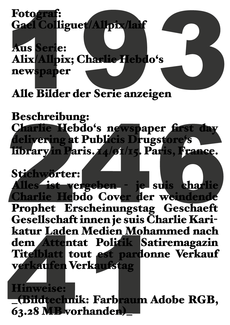Medientheorie
Vertretungsprofessorin im WiSe 2025/26 und SoSe2026
-
Prof. Dr. Alisa Kronberger
T +49 (0)69.800 59-214
Hauptgebäude, Raum 303
Medien meinen mehr als Fotografie, Film, Fernsehen oder Internet. Sie sind nicht einfach technische Artefakte, die man in der Welt als distinkte und stabile Klassen von Objekten vorfindet, vielmehr kann Verschiedenes in die Position der Mitte, des Mittels und des Dazwischen rücken. Viel grundlegender und vielgestaltiger sind Medien Weisen und Operationen der Relationierung und Vermittlung, des Trennens und Verbindens. Sie prägen unsere Wahrnehmungs-, Handlungs- und Denkweisen; konstituieren, unterstützen oder erzwingen historisch spezifische Subjektivierungs- und Individuationsformen; und sind an hybriden Kollektivierungspraktiken aus Menschlichem und Nicht-Menschlichem beteiligt.
Die Professur Medientheorie an der HfG Offenbach vertritt dabei einen operativ-prozessualen Begriff des Medialen. Von Interesse ist, welche Operationen für unterschiedliche mediale Konstellationen charakteristisch sind und welche Prozesse medial ermöglicht oder ausgeschlossen werden. Dies entspricht einer Umstellung von der Logik der Substanzen auf das Denken in Relationen, Prozessen und materiellen Praktiken. Statt der Zeichnung steht der Vorgang des Zeichnens im Vordergrund, statt der Schrift die Prozesse des Schreibens; statt von der Fotografie zu sprechen, gilt es, die Gesten des Fotografierens zu adressieren. Die Affinität für Praktiken, materielle Prozesse und Weisen der medialen Vermittlung und Verfertigung prädestiniert diesen Medienbegriff auch für die Auseinandersetzung mit der künstlerischen und gestalterischen Praxis.
Der Fokus auf mediale Operationen schließt aber nicht aus, die Stabilisierungen derartiger Prozesse in Dispositiven und Assemblagen zu berücksichtigen. Die medialen Operationen finden in konkreten soziokulturellen, politischen und ökonomischen Konstellationen statt und gestalten diese mit. Weder Ressourcen, Zugangs- oder Handlungsoptionen noch Einfluss sind in Medienanordnungen gleich verteilt, was die Aufmerksamkeit für die medial mitbedingten Asymmetrien, Hierarchien oder Ausschlüsse erfordert. Aus diesem Grund muss die Frage nach medialen Prozessen und Operationen auch Macht- und Agency-Analysen einschließen.
Doktorand_innen Prof. em. Dr. Marc Ries
Doktorandinnen
Manuel Ahnemüller
Ornella Fieres
Das okkulte Digitale Phänomene des Okkulten in der Digitalkultur und Gegenwartskunst
Falk Haberkorn
Versuch über die Geste des Fotografierens
Margret Hoppe
Annie Kurz
Patrick Raddatz
Julia Rommel
Ubiquität – Raumkonstitution im Kontext von Informations- und Kommunikationstechnologien
Marian Rupp
Figurale Fabulation Grafische Philosophie und die Verschränkung von Materie und Bedeutung
Mathias Windelberg
Carsten Wolff
Willy Fleckhaus und der kühl kalkulierte Rausch der Farben